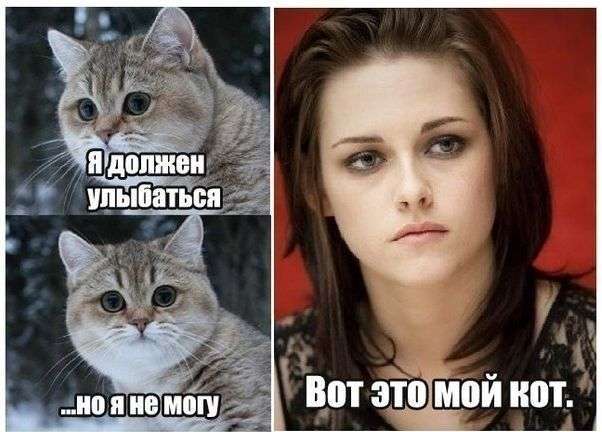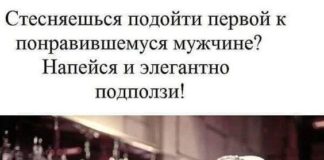Die jüngste Runde der Klimaverhandlungen der Vereinten Nationen, bekannt als COP30, hat in Belém, Brasilien, in einer Atmosphäre voller Spannung und Unsicherheit begonnen. Da sich Delegierte aus fast allen Ländern (außer den USA) versammeln, stellen diese Gespräche einen entscheidenden Zeitpunkt dar und zeigen, wie sich die sich verändernde geopolitische Landschaft der Welt auf ihre Fähigkeit zur Bewältigung der eskalierenden Klimakrise auswirken wird.
Es steht unbestreitbar viel auf dem Spiel. Die COP30 findet vor dem Hintergrund globaler Energieunruhen und zerbrochener internationaler Zusammenarbeit statt. Das Pariser Abkommen, ein bahnbrechendes Abkommen aus dem Jahr 2015, das darauf abzielt, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau (idealerweise 1,5 Grad) zu begrenzen, steht in der Schwebe. Dieser scheinbar geringe Temperaturunterschied hat tiefgreifende Folgen: häufigere und heftigere Hitzewellen, verstärkte Dürren und Waldbrände, steigende Meeresspiegel und ein weit verbreiteter Zusammenbruch des Ökosystems.
Eine drohende Frist und treibender Sand
Die diesjährige COP30 ist von besonderer Bedeutung, da sie eine Frist für die Nationen darstellt, überarbeitete nationale Klimaschutzpläne – sogenannte Nationally Determined Contributions (NDCs) – im Einklang mit den Zielen des Pariser Abkommens vorzulegen. Mehr als 110 Länder haben dies bereits getan, aber viele dieser Zusagen reichen nach wie vor nicht aus, um eine katastrophale Erwärmung abzuwenden. Entscheidend ist, dass mehrere Schlüsselakteure ihre Verpflichtungen noch nicht eingegangen sind, was einen Schatten auf den gesamten Prozess wirft.
Zu ihnen gehören die Vereinigten Staaten, der weltweit größte historische Emittent von Treibhausgasen und derzeit der zweitgrößte Umweltverschmutzer. Die Entscheidung von Präsident Trump aus dem Jahr 2017, aus dem Pariser Abkommen auszutreten, war ein schwerer Schlag, da er nicht nur ein wichtiges Versprechen aufgab, sondern auch die internationale Zusammenarbeit gefährdete. Auch wenn die USA keine offizielle Delegation zur COP30 entsenden, sendet ihre Abwesenheit ein besorgniserregendes Signal über ihr Engagement für globale Klimaschutzmaßnahmen.
Über den Rückzug der USA hinaus drohen weitere große Herausforderungen. Ein Anstieg der nationalistischen Stimmung bedroht den Multilateralismus – die Grundlage, auf der globale Abkommen wie das Pariser Abkommen basieren. Der rasante Aufstieg der künstlichen Intelligenz (KI) treibt den Energiebedarf in die Höhe und gibt Anlass zur Sorge über einen damit einhergehenden Anstieg der Emissionen. Sogar wohlmeinende Persönlichkeiten wie Bill Gates haben kürzlich Klimarisiken heruntergespielt und sich gleichzeitig für die KI-Entwicklung eingesetzt und dabei die komplexen und oft widersprüchlichen Prioritäten hervorgehoben.
Ein prekärer Balanceakt: Anpassung, Finanzierung und Schadensbegrenzung
Die COP30-Agenda geht diese vielfältigen Herausforderungen gezielt an. Die Delegierten beschäftigen sich mit der Frage, wie die Finanzierung von Klimaanpassungsprojekten aufgestockt werden kann, um Gemeinden dabei zu helfen, mit den bereits unbestreitbaren Auswirkungen des Klimawandels wie extremen Wetterereignissen und dem Anstieg des Meeresspiegels umzugehen. Ebenso dringend ist es, einen Mechanismus zu schaffen, um jährlich 1,3 Billionen US-Dollar an Finanzmitteln für Entwicklungsländer zu mobilisieren, damit diese auf saubere Energiequellen umsteigen und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber den eskalierenden Auswirkungen des Klimawandels stärken können.
Gleichzeitig werden sich die Verhandlungen auf die Intensivierung der Bemühungen zur Reduzierung der Emissionen – sogenannte Mitigation – konzentrieren. Dazu gehört der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, die nach wie vor der Haupttreiber der globalen Erwärmung sind, und die Beschleunigung des Einsatzes erneuerbarer Energietechnologien wie Solar- und Windkraft.
Während jüngste Emissionsprognosen darauf hindeuten, dass eine Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius nun wahrscheinlich unerreichbar ist, bleibt die Vermeidung einer katastrophalen Erwärmung über 2 Grad Celsius in greifbarer Nähe. Um dies zu erreichen, sind jedoch schnelle und entschlossene Maßnahmen aller Nationen und nicht nur einiger weniger Auserwählter erforderlich.
COP30 ist eine deutliche Erinnerung daran, dass die Uhr tickt, um eine Klimakatastrophe abzuwenden. Ob dieser entscheidende Moment einen Wendepunkt hin zu kollektivem Handeln oder einen weiteren Abstieg in die Untätigkeit markiert – eine Zukunft, die von immer häufigeren und schwerwiegenderen Extremwetterereignissen und einem kaskadenartigen ökologischen Zusammenbruch geprägt ist – bleibt abzuwarten. Die Welt schaut zu und wartet inmitten des Treibsands auf Anzeichen von Führung.